Wir freuen uns über Gedanken und Kommentare über die Kommentarfunktion am Ende des Beitrags.
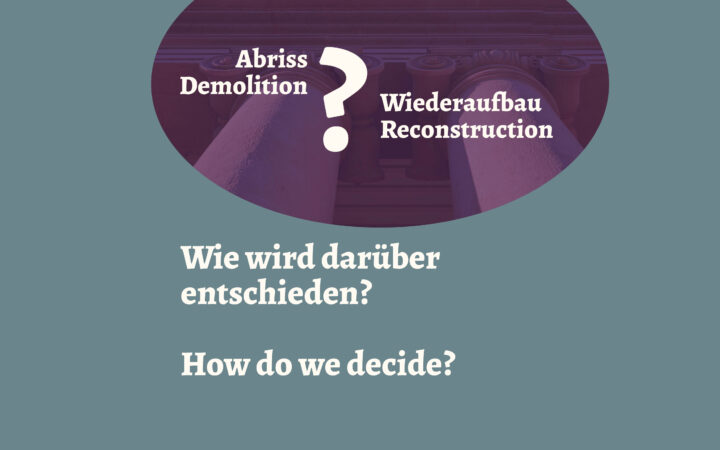
„Ein Gebäude zu restaurieren, bedeutet nicht, es instand zu halten, es zu reparieren oder zu erneuern. Vielmehr bedeutet es, es in einem vollständigen Zustand wiederherzustellen, den es möglicherweise noch nie gab.“ Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc‚ ‚Restauration‘, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, Bd. VIII, 1866
„[…] es ist ganz ‚unmöglich‘, so unmöglich wie die Toten zu erwecken, irgend etwas wiederherzustellen, das jemals groß oder schön in der Baukunst gewesen ist. […] der Geist, der nur durch die Hand und das Auge des Arbeiters übertragen wird, kann niemals wieder zurückgerufen werden. […] Lasst uns also lieber gar nicht von Wiederherstellung reden. Die Sache ist eine Lüge von Anfang bis Ende.“ John Ruskin, The Seven Lamps of Architecture, 1849
Schon im 19. Jahrhundert wurde über die Positionen Wiederherstellen oder Konservieren heiß diskutiert. Der englische Kunstkritiker John Ruskin gehörte zu den Verfechtern des Konservierens, der französische Architekt Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc sprach sich für das Wiederherstellen aus, um nur zwei Positionen anzuführen.
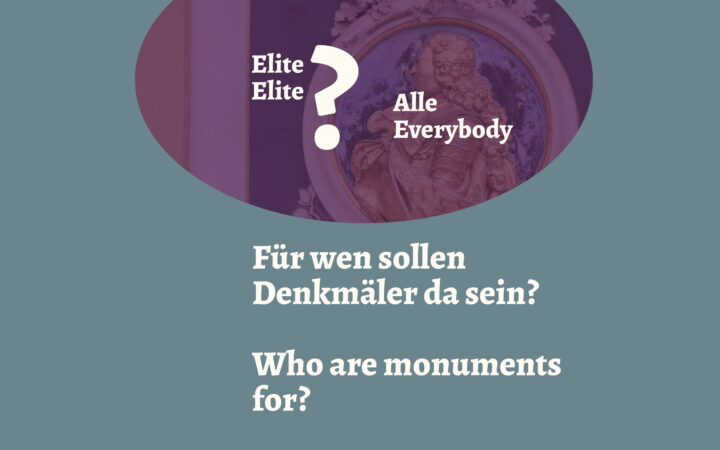
„Als lebendige Zeugnisse jahrhundertealter Traditionen der Völker vermitteln die Denkmäler in der Gegenwart eine geistige Botschaft der Vergangenheit. Die Menschheit, die sich der universellen Geltung menschlicher Werte mehr und mehr bewußt wird, sieht in den Denkmälern ein gemeinsames Erbe und fühlt sich kommenden Generationen gegenüber für die Bewahrung gemeinsam verantwortlich. Sie
hat die Verpflichtung, ihnen die Denkmäler im ganzen Reichtum ihrer Authentizität weiterzugeben.
Es ist daher wesentlich, daß die Grundsätze, die für die Konservierung und Restaurierung der Denkmäler maßgebend sein sollen, gemeinsam erarbeitet und auf internationaler Ebene formuliert werden, wobei jedes Land für die Anwendung im Rahmen seiner Kultur und seiner Tradition verantwortlich ist.“ Auszug aus der Präambel der Charta von Venedig – zur Konservierung und Restaurierung historischer Denkmäler und Ensembles, 1964
Noch bevor es Denkmalschutzgesetze gab, kamen 1964 in Venedig Architekten und Denkmalpfleger zusammen, um auf dem II. Internationalen Kongreß der Architekten und Techniker der Denkmalpflege über die Aufgaben und Handlungsgrundlagen der Denkmalpflege zu diskutieren. Ergebnis war die Charta von Venedig, ein Thesenpapier, das bis heute wichtige Grundlage für den internationalen Umgang mit historischer Bausubstanz ist. In den 1970er Jahren wurde die Charta von Venedig in Deutschland zur Grundlage für die Formulierung der Denkmalschutzgesetze.
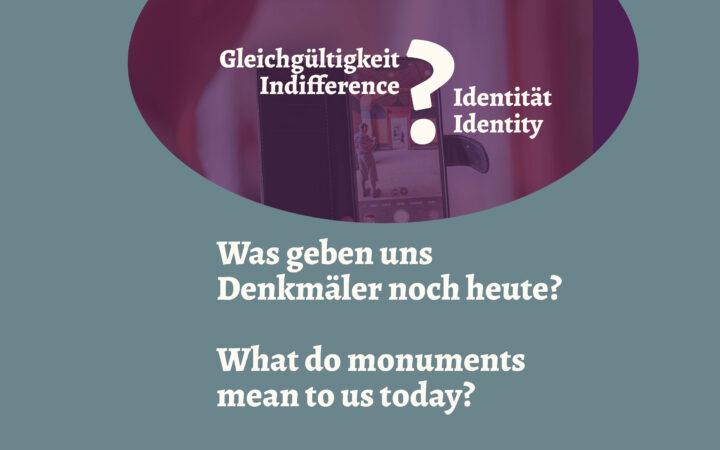
„Denkmale schützen heißt, unsere kulturelle Identität zu schützen und zu bewahren. Denkmale zu schützen bedeutet auch, Geschichte, Geschichten und Zeitgeist an authentischen Orten der Erinnerung lebendig zu halten. Und Denkmale zu schützen meint, die Kunstfertigkeit und kreative Kraft der Menschen zu bewahren.“ Homepage der Deutschen Stiftung Denkmalschutz
Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz wurde 1985 gegründet und ist die größte private Initiative für Denkmalpflege in Deutschland. Ihre Arbeit reicht von der Notfall-Rettung gefährdeter Denkmale über pädagogische Schul- und Jugendprogramme bis zum bundesweiten Tag des offenen Denkmals.
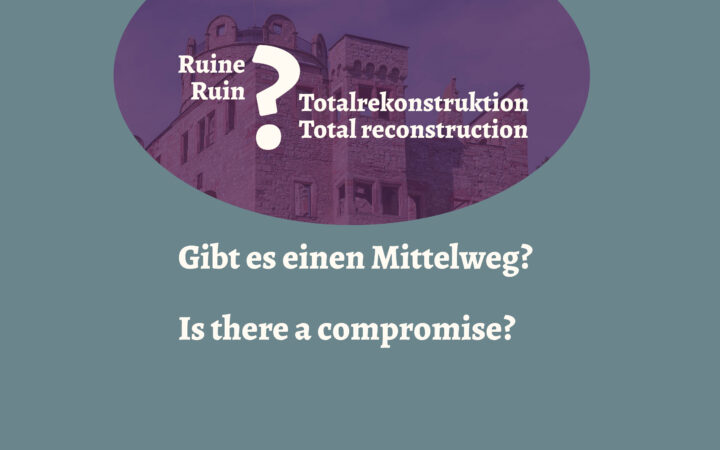
„Verlieren würden wir das Echte und gewinnen die Imitation; verlieren das historisch Gewordene und gewinnen das zeitlos Willkürliche; verlieren die Ruine, die altersgraue und doch so lebendig zu uns sprechende, und gewinnen ein Ding, das weder alt noch neu ist, eine tote akademische Abstraktion. Zwischen diesen beiden wird man sich zu entscheiden haben.“ Georg Dehio, Was wird aus dem Heidelberger Schloß werden?, 1901
Vor dem Hintergrund des Wirtschaftswachstums im 19. Jahrhundert und den damit verbundenen Stadterweiterungen sowie den historistischen Restaurationen, entbrannte um 1900 ein Streit unter Fachleuten. In den Fokus rückte die Wiederherstellung des Heidelberger Schlosses. Das durch einen Blitzeinschlag im 18. Jahrhundert ausgebrannte Schloss sollte im 19. Jahrhundert durch den Architekten Carl Schäfer wiederhergestellt werden. So wurde zunächst der Friedrichsbau rekonstruiert, als nächstes sollte der Ottoheinrichsbau wiederhergestellt werden. Die Planungen sahen eine Rekonstruktion der Schaufassaden mit Neuschöpfungen vor und brachten den Stein ins Rollen. In seiner Streitschrift Was wird aus dem Heidelberger Schloß werden? sprach sich Georg Dehio, Professor für Kunstgeschichte, mit Nachdruck gegen die Rekonstruktion des Ottoheinrichsbaus aus. Eine Diskussion über die Aufgaben und Grundsätze der Denkmalpflege entbrannte. Was das Heidelberger Schloss betrifft, so konnten sich letztlich die Wiederherstellungsgegner durchsetzen, die Ruine blieb erhalten.

„[…] der Herzog auf einem Umbau anstatt eines Neubaues bestand, trotzdem ich darlegte, daß der Umbau zeitraubender, umständlicher und kostspieliger sei als ein Neubau, und daß er eine Masse Konsequenzen in den niedrigen Stockhöhen, unzweckmäßigen Konstruktion usw. habe.“ Schreiben von Hofbaumeister Albert Neumeister zum Umbau von Schloss Altenstein unter Herzog Georg II. von Sachsen-Meiningen
Beim Umbau von Schloss Altenstein am Ende des 19. Jahrhunderts legte Herzog Georg II. Wert auf die Erhaltung der historischen Bausubstanz des Vorgängerbaus, auch wenn das in Teilen zu Lasten des Komforts ging. Georgs Großvater Georg I. bemühte sich schon um 1800 um den Erhalt der Burgruine Bad Liebenstein. Auf der Veste Heldburg wiederum schuf sich Georg II. sein Märchenschloss.
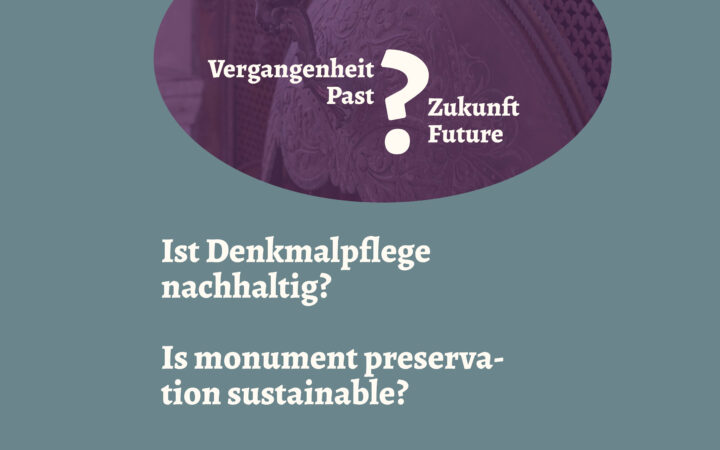
„Denkmäler sind mehr als historische Bauwerke – sie sind auch Vorbilder für einen wirkungsvollen Klimaschutz. Der Erhalt unseres baukulturellen Erbes leistet einen wichtigen Beitrag zu den Klimazielen, denn jedes Denkmal bewahrt wertvolle Ressourcen und vermeidet die Verschwendung sogenannter „grauer Energie“, die im Abriss bestehender Gebäude und in der Errichtung neuer Gebäude steckt.
Die Denkmalpflege zeigt, wie Klimaschutz im Gebäudebestand nachhaltig gelingen kann: durch die Verlängerung der Nutzungsdauer, die Reparaturfähigkeit und Nachnutzbarkeit sowie durch ressourcenschonende Lösungen. Denkmäler sind langlebig, bestehen aus dauerhaften Materialien und haben bereits jetzt erhebliche Mengen CO₂ eingespart. Diese Eigenschaften machen sie zu perfekten Beispielen für eine nachhaltige „Green Culture“.“ Homepage der Vereinigung der Denkmalfachämter in den Ländern
Die Vereinigung der Denkmalfachämter in den Ländern (VDL) ist auf bundesweiter Ebene tätig.

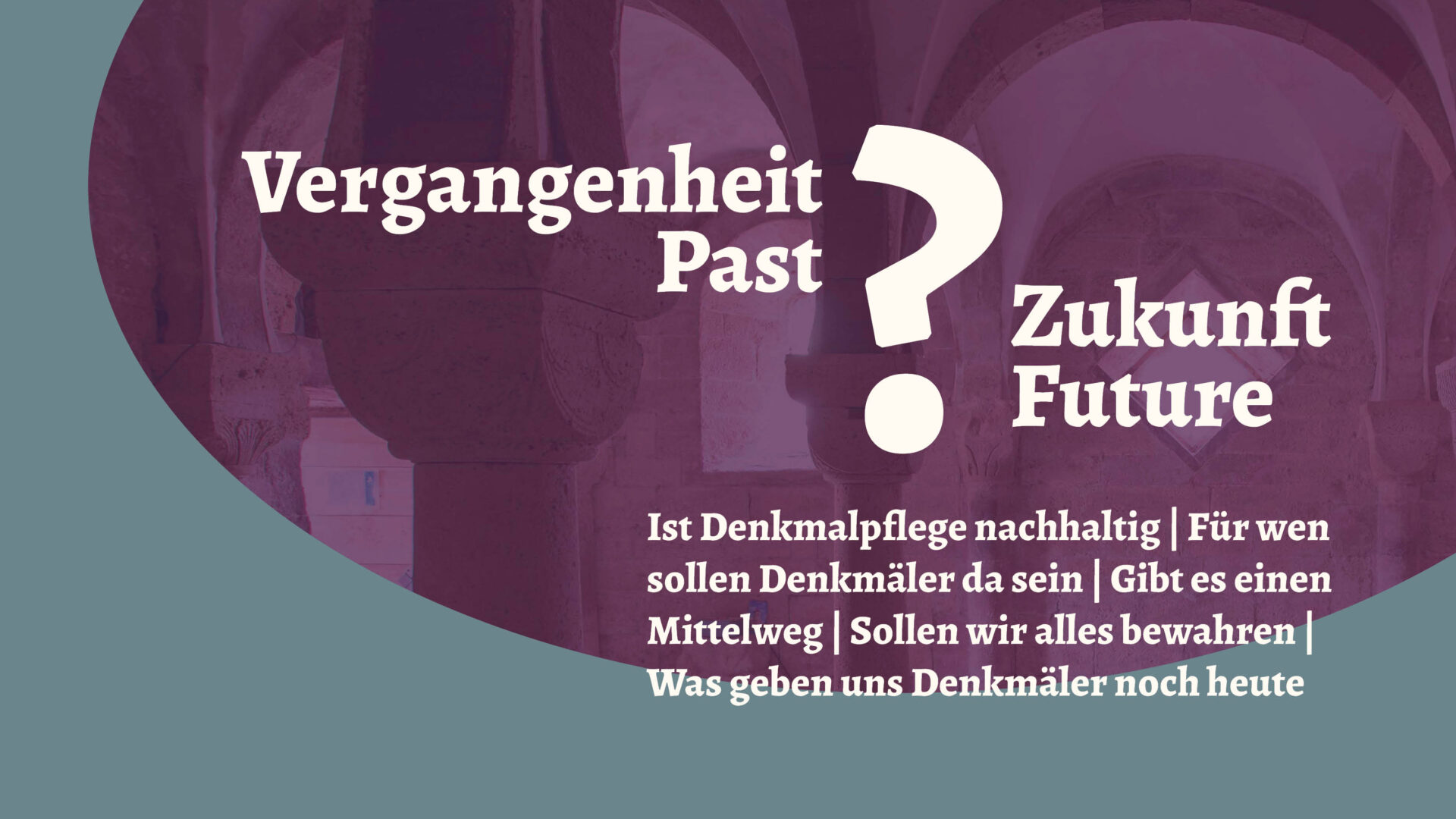



Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Noch nicht angemeldet? Hier geht es zur Registrierung.